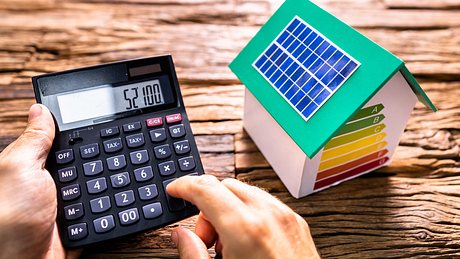Power Station mit Solarmodulen: Mobile Alternative zum Balkonkraftwerk?
Mit über einer Million angemeldeter Balkonkraftwerke in Deutschland boomt die private Solarenergie in Deutschland. Powerstations mit Solarpanels stellen eine mobile Alternative dar – kann sich das lohnen?
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link bzw. mit Symbol) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
- Grundlagen der Balkonkraftwerk-Technologie
- Aktuelle Regelungen für Balkonkraftwerke in Deutschland
- Powerstations als mobile Solarenergie-Lösung
- Balkonkrafwerk und Powerstation – was kostet wie viel?
- Leistungsvergleich zwischen festen und mobilen Systemen
- Nutzungsszenarien für Powerstations und Balkonkraftwerke
- Balkonkraftwerke: Strom für den direkten Verbrauch
- Powerstations: Mobile Stromquelle mit Speicher für unterwegs
- Wartung und Lebensdauer der beiden Systeme
- Powerstation und Balkonkraftwerk: Rechtliche Aspekte im Vergleich
- Balkonkraftwerke mit Solarspeicher: Vor- und Nachteile im Vergleich zur Powerstation
- Balkonkraftwerk mit Speicher: Das ist anders als bei der Powerstation
- Fazit: Balkonkraftwerk oder Powerstation?
Bis Ende Juni 2025 wurden bereits über eine Million Balkonkraftwerke im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur erfasst – der Boom privater Mini-PV-Anlagen in Deutschland ist ungebrochen. Doch längst nicht jeder hat einen geeigneten Balkon oder eine passende Terrasse für ein klassisches Balkonkraftwerk. Eine interessante Alternative bieten mobile Powerstations mit anschließbaren Solarpanels, die Flexibilität und Unabhängigkeit vom Stromnetz versprechen.
Grundlagen der Balkonkraftwerk-Technologie
Bevor wir uns den mobilen Alternativen widmen, lohnt ein kurzer Blick auf die Funktionsweise konventioneller Balkonkraftwerke. Diese bestehen aus einem bis vier Solarmodulen, einem Mikrowechselrichter und passenden Anschlusskabel für die Solarmodule sowie für die Verbindung mit dem Hausnetz. Der in den Panels erzeugte Gleichstrom wird durch den Wechselrichter direkt in Wechselstrom umgewandelt und dann ins Hausnetz eingespeist.
Seit Mai 2024 gelten dabei neue Regeln für Balkonkraftwerke: 2.000 Wattpeak Solarleistung bei einer maximalen Einspeiseleistung von 800 Watt ins Hausnetz sind erlaubt. Die Anlagen müssen dazu lediglich im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur angemeldet werden. Diese Vereinfachungen haben den Markt erheblich angekurbelt und private Solarenergie für die breite Masse noch interessanter gemacht.
Aktuelle Regelungen für Balkonkraftwerke in Deutschland
Die Anmeldung eines Balkonkraftwerks ist in Deutschland auch 2025 noch verpflichtend und dient dazu, Transparenz über dezentrale Stromerzeugungsanlagen zu schaffen. Dazu soll die Netzstabilität gewährleistet werden. Der Prozess wurde für Steckersolargeräte bis 800 Watt Einspeiseleistung jedoch erheblich vereinfacht: Eine einfache Online-Registrierung im Marktstammdatenregister reicht völlig aus und ist in wenigen Minuten erledigt. Der bürokratische Aufwand bleibt minimal – eine Anmeldung beim Netzbetreiber entfällt vollständig.
Neben der angehobenen Einspeise-Grenze besonders wichtig: Vermieter können die Installation eines Balkonkraftwerkes nicht mehr ohne triftigen Grund untersagen. Für Mieter bedeutet dies deutlich gestärkte Rechte beim Betreiben eigener Solaranlagen.
Powerstations als mobile Solarenergie-Lösung
Powerstations mit Solarpanels funktionieren nach einem anderen Prinzip als festinstallierte Balkonkraftwerke. Statt den erzeugten Strom direkt ins Hausnetz einzuspeisen, wird er in einem integrierten Lithium-Akku gespeichert. Diese Systeme bestehen aus einer tragbaren Batterie-Station mit verschiedenen Ausgängen und einem oder mehreren klappbaren Solarpanels, die sich schnell aufbauen und wieder verstauen lassen.
Die Kapazitäten der Geräte reichen dabei von kompakten 200 Wattstunden bis zu leistungsstarken Systemen mit über 1.500 Wattstunden. Ein MPPT-Laderegler optimiert auch hier die Solarstrom-Ausbeute, während ein integrierter Wechselrichter 230-Volt-Wechselstrom für handelsübliche Geräte bereitstellt.
Anders als Balkonkraftwerke sind diese Systeme völlig netzunabhängig und erfordern entsprechend keinerlei Anmeldung. Zudem sind Powerstations trotz des Gewichtes fast immer mobil. Selbst größere Varianten können problemlos im Kofferraum eines Autos oder in einem Camper transportiert und im Park, auf dem Campingplatz oder am Strand genutzt werden
Balkonkrafwerk und Powerstation – was kostet wie viel?
Ein komplettes Balkonkraftwerk der Einsteiger-Kategorie kostet aktuell zwischen 250 und 500 Euro. Dafür erhält man meist zwei 450-Watt-Module mit Mikrowechselrichter und Montagematerial. Die Anschaffungskosten amortisieren sich durch die kontinuierliche Stromproduktion und den direkten Eigenverbrauch im Hausnetz, der den Strombezug aus dem öffentlichen Netz reduziert. Zusätzliche Betriebskosten entstehen bei einem Balkonkraftwerk praktisch nicht.
Powerstations mit entsprechender Solarkapazität bewegen sich preislich zwischen 800 und 2.500 Euro, je nach Akkukapazität und Solarleistung. Ein 1.000-Wattstunden-Modell mit Solarpanel kostet etwa 900 bis 1.300 Euro. Die rechnerische Amortisation dauert hier deutlich länger, da der Energieertrag aufgrund der Bauform geringer ausfällt und die Akkus nach ca. acht bis zehn Jahren ersetzt werden müssen. Tatsächlich sind Powerstations aber auch nicht primär für den Zweck des Stromkosten-Sparens gedacht.
Leistungsvergleich zwischen festen und mobilen Systemen
Ein typisches 800-Watt-Balkonkraftwerk erzeugt in Deutschland jährlich etwa 600 bis 800 Kilowattstunden Strom, abhängig von Ausrichtung und Standort. Bei aktuellen Strompreisen von rund 40 Cent pro Kilowattstunde und einem durchschnittlichen Eigenverbrauch von 50 Prozent entspricht das einer jährlichen Ersparnis von 120 bis 160 Euro im Jahr. Die Amortisation erfolgt, je nach Anschaffungspreis, meist innerhalb von zwei bis vier Jahren.
Mobile Powerstations erreichen deutlich geringere Jahreserträge. Das liegt einerseits an der geringeren Solar-Leistung, da eine Powerstation häufig mit einem 100- oder 200-Wp-Solarpanel ausgeliefert wird – es gibt aber auch Varianten mit 400-Wp-Panels. Unter optimalen Bedingungen könnten so maximal 300 bis 400 Kilowattstunden pro Jahr erzeugt werden. Da die Panels jedoch in der Regel nicht dauerhaft aufgebaut sind und häufig transportiert werden, liegt der praktische Ertrag oft deutlich darunter. Die Energieausbeute pro investiertem Euro ist somit auch erheblich geringer.
Nutzungsszenarien für Powerstations und Balkonkraftwerke
Balkonkraftwerke eignen sich aufgrund ihrer Bauform optimal für feste Standorte mit guter Südausrichtung. Sie decken dabei kontinuierlich den Grundverbrauch im Haushalt ab – etwa für Kühlschrank, Router und weitere Standby-Verbräuche. Der erzeugte Strom wird direkt verbraucht oder ins Netz eingespeist. Dabei kann die Einspeisung auch mit einem Smart Meter oder smarten Haushaltsgeräten kombiniert werden, um den Eigenverbrauchsanteil des erzeugten Stroms zu erhöhen.
Powerstations punkten dagegen durch ihre Mobilität. Camping, Gartenarbeit, Outdoor-Events oder Notfallvorsorge sind typische Einsatzgebiete. Die gespeicherte Energie steht dabei auch nachts oder bei bewölktem Himmel immer zur Verfügung. Die Geräte sind dabei weniger für die Kostensenkungen im Alltag, sondern für die netzunabhängige Nutzung von Geräten gedacht. Dazu sind die Lade-Entlade-Verluste des Akkus zu berücksichtigen, die insgesamt etwa 10 bis 15 Prozent der Energie kosten können.
Balkonkraftwerke: Strom für den direkten Verbrauch
Balkonkraftwerke nutzen Mikrowechselrichter, die den Gleichstrom der Module direkt in netzkonformen Wechselstrom umwandeln. Die Effizienz liegt hier laut Experten und Datenblättern meist bei über 95 Prozent. Ist kein Solar-Batteriespeicher verbaut, wird der Strom sofort im Haushalt verbraucht bzw. ins Netz eingespeist.
Bei Inbetriebnahme ist häufig ein Zählertausch erforderlich, damit rückwärts laufende Zähler vermieden werden. Diese sind aber übergangsweise erlaubt, zudem ist hier der Netzbetreiber in der Pflicht, einen neuen Zähler zu installieren.
Powerstations: Mobile Stromquelle mit Speicher für unterwegs
Powerstations hingegen arbeiten immer mit einem mehrstufigen Energiewandlungsprozess, da es keine direkte Netzeinspeisung gibt. Der Solar-Gleichstrom wird zunächst zum Laden der Lithium-Akkus verwendet und bei Bedarf durch einen eingebauten Wechselrichter in Wechselstrom gewandelt. Dieser kann dann über herkömmliche Steckdosen an der Powerstation abgerufen werden.
Jeder Umwandlungsschritt verursacht dabei Verluste. Wie erwähnt betragen die Lade-Entlade-Verluste des Akkus etwa zehn Prozent und auch die Stromwandlung durch den Wechselrichter führt zu (etwas geringeren) Verlusten. So liegt der Gesamtwirkungsgrad am Ende dadurch bei rund 80 bis 85 Prozent.
Wartung und Lebensdauer der beiden Systeme
Balkonkraftwerke sind nach Aufbau und Inbetriebnahme praktisch wartungsfrei. Die Module halten laut Herstellergarantie mindestens 20 bis 25 Jahre, die Mikrowechselrichter meist mindestens 10 bis 15 Jahre. Eine gelegentliche Reinigung der Moduloberflächen und die Prüfung der Halterungen reicht als Pflege des Gerätes häufig aus. Reparaturen sind selten nötig, da keinerlei bewegliche Teile vorhanden sind.
Powerstations erfordern im Grunde kaum mehr Aufmerksamkeit, halten allerdings nicht so lange. Das liegt vor allem an der Akku-Technologie. Moderne Lithium-Akkus verlieren nach etwa 3000 bis 4000 Ladezyklen spürbar an Kapazität. Bei täglicher Nutzung entspricht das ungefähr einer Lebensdauer von acht bis zehn Jahren. Danach muss das System ersetzt werden, da Powerstations keinen Akkutausch vorsehen.
Die Solarpanels selbst halten theoretisch ähnlich lange wie bei festen Systemen, werden aber durch Bewegung mechanisch stärker beansprucht. Dazu sind die Module oft nicht so wetterfest wie ihre starren Kollegen, was zu einem schnelleren Ausfall führen kann. Hersteller wie Jackery oder Ecoflow geben nur 12 bis 24 Monate Garantie, dazu wird davon abgeraten, die Geräte bei Regen zu benutzen.
Powerstation und Balkonkraftwerk: Rechtliche Aspekte im Vergleich
Betreiber von Balkonkraftwerken sind gesetzlich verpflichtet, ihre Anlage im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur zu registrieren. Diese Anmeldepflicht gilt für alle netzgekoppelten Anlagen, unabhängig von ihrer Größe. Verstöße können theoretisch mit Bußgeldern von bis zu 50.000 Euro geahndet werden, praktisch wird aber meist nur zur Nachmeldung aufgefordert.
Mobile Powerstations unterliegen hingengen keiner Anmeldepflicht, da sie nicht mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden sind. Sie gelten als normale Elektrogeräte ohne besondere Auflagen. Auch eine Meldung an den Netzbetreiber oder die Bundesnetzagentur entfällt. Entsprechend einfach können die Geräte genutzt werden – ob auf Reisen, im Gartenhaus oder im Park.
Balkonkraftwerke mit Solarspeicher: Vor- und Nachteile im Vergleich zur Powerstation
Das Konzept des Energiespeichern ist nicht nur mobilen Lösungen vorbehalten. Auch Balkonkraftwerke lassen mit einem fest installierten Solarspeicher kombinieren. Dabei wird der erzeugte Solarstrom nicht sofort ins Hausnetz eingespeist, sondern zunächst in einer stationären Batterie gespeichert. Dies ermöglicht es, den Strom auch in den Abendstunden oder bei geringer Sonneneinstrahlung zu nutzen.
Insbesondere in Verbindung mit einem Smart Meter, intelligenten Steckdosen oder anderen Smarthome-Geräten kann so Strom gespart werden, da die Energie genau dann abgerufen wird, wenn sie gebraucht wird. Allerdings hat ein Stromspeicher auch Nachteile, allen voran die deutlich höheren Kosten bei der Anschaffung.
Vorteile eines Balkonkraftwerks mit Speicher:
Höherer Eigenverbrauchsanteil: Mehr des erzeugten Stroms kann selbst genutzt werden.
Unabhängigkeit vom Tagesverlauf: Strom steht auch abends und nachts zur Verfügung.
Senkung der Stromkosten: Durch die zeitversetzte Nutzung wird der Zukauf aus dem Netz weiter reduziert.
Nachteile eines Balkonkraftwerks mit Speicher:
Höhere Anschaffungskosten: Speicher erhöhen die Investition oft deutlich - je nach Speichergröße.
Wirkungsgradverluste: Durch Lade- und Entladevorgänge gehen etwa zehn Prozent der Energie verloren.
Nulleinspeisung klappt nicht einfach so: Ohne die Nutzung eines Smart Meters wird weiterhin Strom ins Netz verschenkt.
Balkonkraftwerk mit Speicher: Das ist anders als bei der Powerstation
Während eine Powerstation eine mobile Einheit mit integriertem Akku ist, dient ein stationärer Solarspeicher ausschließlich der Unterstützung eines fest installierten Balkonkraftwerks. Powerstations hingegen werden in der Regel nicht ins Hausnetz eingebunden, sondern versorgen Geräte direkt über integrierte Steckdosen.
Ein Solarspeicher ist hingegen dauerhaft mit dem Wechselrichter und Hausnetz verbunden, was eine effizientere Nutzung für den Haushaltsbedarf ermöglicht, jedoch weniger flexibel und mobil ist. Allerdings gibt es seit Jahresbeginn 2025 vermehrt neue Solarspeicher-Modelle, die durch ein modulares Konzept und Geräte-Varianten ohne Solareingänge in den Gefilden von Powerstations wildern und selbst über Steckdosen verfügen, an die sich Haushaltsgeräte anschließen lassen.
Fazit: Balkonkraftwerk oder Powerstation?
Für feste Standorte mit guter Sonneneinstrahlung bleiben klassische Balkonkraftwerke die wirtschaftlichere Wahl. Sie bieten höhere Erträge, längere Lebensdauer und eine schnellere Amortisation.
Powerstations mit Solarpanels punkten durch ihre Flexibilität und Unabhängigkeit. Für Camper, Gartenbesitzer ohne Stromanschluss oder als Notfallvorsorge können sie sinnvoll sein. Wer jedoch primär Stromkosten sparen möchte, fährt mit einem fest installierten Balkonkraftwerk meist besser. Die Entscheidung hängt letztendlich stark von den individuellen Nutzungsgewohnheiten und Prioritäten ab.
Das könnte Sie auch interessieren ...