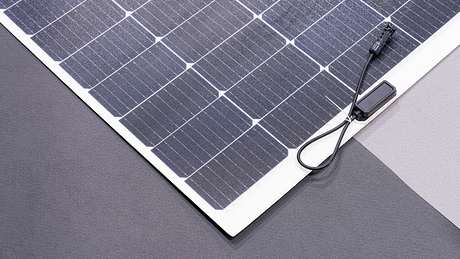Wechselrichter beim Balkonkraftwerk: Darauf müssen Sie achten
Wie funktioniert ein Mikro-Wechselrichter, welche Aufgabe übernimmt er beim Balkonkraftwerk? Was man beim Kauf berücksichtigen sollte und welche Marken besonders zuverlässig sind, verrät dieser Ratgeber.
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link bzw. mit Symbol) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
- Funktionsweise eines Mikrowechselrichters beim Balkonkraftwerk
- 800-Watt-Wechselrichter: Das sagt der Gesetzgeber
- Was kostet ein Wechselrichter fürs Balkonkraftwerk?
- MPP-Tracker beim Wechselrichter – wozu das Ganze?
- Wie schließt man einen Wechselrichter an?
- Wechselrichter: Kompatibilität, Garantie & Co.
- Wechselrichter von Balkonkraftwerken können was ab
- Welche Wechselrichter sind empfehlenswert?
- Sicherheit von Wechselrichtern: Der NA-Schutz und Stiftung Warentest
Seit sich immer mehr Menschen für Sonnenstrom vom heimischen Balkon begeistern, kommen sie auch vermehrt mit deren Mikro-Wechselrichtern in Berührung. Was vor allem im Bereich der Aufdach-PV-Anlagen lange Jahre eine Sache für Photovoltaik-Installateure war, hat man bei der Anbringung der Solarmodule am Balkongeländer oder im Garten plötzlich selbst in der Hand. IP-Zertifizierung? NA-Schalter? MPP-Tracker? Nach der Lektüre dieses Wechselrichter-Ratgebers müssen Sie bei diesen Fachgriffen nicht mehr ratlos mit den Schultern zucken.
Spätestens mit dem vielzitierten Fall der 600-Watt-Grenze im Rahmen des Solarpakets I wurde der Fokus noch einmal vermehrt auf die Schaltzentralen der Balkonkraftwerke gerichtet: Denn entscheidend für die Zulassung als Balkonkraftwerk ist – hinsichtlich der neuen 800-Watt-Grenze – in erster Linie nicht die Wattpeak-Leistung der Solarmodule (hier sind sogar 2.000 Wp erlaubt), sondern die Höhe der elektrischen Leistung in Watt, die der Wechselrichter maximal ins Hausnetz einspeist.
Funktionsweise eines Mikrowechselrichters beim Balkonkraftwerk
Um die grundlegende Funktionsweise eines Mikrowechselrichters zu verstehen, kann es helfen, den Prozess aus Stromerzeugung und -umwandlung bei einem Balkonkraftwerk in fünf Schritte zu unterteilen:
Stromerzeugung: Die Solarmodule erzeugen Gleichstrom (DC) aus Sonnenlicht, dieser Gleichstrom wird per Solarkabel an den Wechselrichter geleitet.
Leistungsmaximierung: Schon an dieser Stelle greift eine Funktionalität des Wechselrichters ins Getriebe. Der dort verbaute Maximum Power Point Tracker (kurz: MPP-Tracker) reguliert die Spannung und sorgt dafür, dass die Module immer im optimalen Arbeitspunkt betrieben werden, um die maximale Leistung zu erzielen.
Umwandlung: Der Mikrowechselrichter wandelt den ankommenden Gleichstrom in Wechselstrom (AC) um. Dazu wird intern eine hochfrequente Wechselspannung erzeugt, die mittels Pulsweitenmodulation zu einer möglichst sauberen Sinuswelle wird – die ist erforderlich, damit der Strom als Wechselstrom ins öffentliche bzw. heimische Netz eingespeist werden kann.
Einspeisung: Der so erzeugte Wechselstrom gelangt über ein Stromkabel zu einer herkömmlichen Schuko-Steckdose oder einer Wieland-Steckdose und dadurch in das Stromnetz des Haushalts.
Überwachung: Viele Mikrowechselrichter bieten Funktionen zur Überprüfung des Ertrags per WLAN an – über eine App für iOS und Android oder ein PC-Tool lassen sich so die eigenen PV-Erträge kontrollieren und auf Wunsch optimieren.
800-Watt-Wechselrichter: Das sagt der Gesetzgeber
Im Mai 2024 trat das Solarpaket I der alten Bundesregierung in Kraft, das sorgte für einige Änderungen beim Erneuerbare-Energien-Gesetz. Unter anderem ging es dabei um Bürokratie-Abbau bei und mehr Leistung für Balkonkraftwerke. Die werden im Behördendeutsch des Bundesgesetzblatts nach wie vor Steckersolargerät genannt: "Ein Steckersolargerät ist ein Gerät, das aus einer Solaranlage oder aus mehreren Solaranlagen, einem Wechselrichter, einer Anschlussleitung und einem Stecker zur Verbindung mit dem Endstromkreis eines Letztverbrauchers besteht."
Seit dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes am 16. Mai 2024 darf der Mikro-Wechselrichter eines Balkonkraftwerks nun 800 statt wie zuvor 600 Watt ins Netz einspeisen. Im Gesetz klingt das so: "Ein Steckersolargerät oder mehrere Steckersolargeräte mit einer installierten Leistung von insgesamt bis zu 2 Kilowatt und einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu 800 Voltampere, die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden, (…) können unter Einhaltung der für die Ausführung eines Netzanschlusses maßgeblichen Regelungen angeschlossen werden. Registrierungspflichten nach der Marktstammdatenregisterverordnung bleiben unberührt; zusätzliche gegenüber dem Netzbetreiber abzugebende Meldungen von Anlagen nach Satz 1 können nicht verlangt werden."
Die Bemessung der Wechselrichter-Leistung in Voltampere ist hier übrigens als Synonym zu Watt zu verstehen. Der Gesetzestext macht auch klar: Mehrere Balkonkraftwerke wären in einem Haushalt also durchaus erlaubt, deren kombinierte Wechselrichterleistung darf 800 Watt aber nicht überschreiten.
Was kostet ein Wechselrichter fürs Balkonkraftwerk?
Ein 800-Watt-Wechselrichter für Balkonkraftwerke kostet aktuell (Stand: April 2025) je nach Hersteller, Modell und natürlich der Angebotslage in diversen Online-Shops zwischen 85 und 140 Euro. Zu den bestverkauften Geräten hierzulande zählen der Hoymiles HMS-800W-2T, der Growatt NEO 800M-X oder der Deye Sun M80-G4. All diese Geräte verfügen über zwei MPP-Tracker sowie WLAN-Funktionalität und sind speziell für den Einsatz in Balkonsolaranlagen konzipiert.
Für die anschließende Überwachung des PV-Ertrags fallen in der Regel keine zusätzlichen Kosten an, da die großen Hersteller meist Gratis-Apps für Android- und iOS-Geräte anbieten. Wer die meist mit einer Online-Cloud-Nutzung einhergehenden Dienste der chinesischen Hersteller meiden möchte, hat diverse DIY-Optionen, um an seine PV-Daten zu kommen – diese erfordern aber allesamt erheblich mehr Computer-Know-how als die Nutzung einer simplen Smartphone-App.
MPP-Tracker beim Wechselrichter – wozu das Ganze?
Wie oben erwähnt dient der in modernen Mikro-Wechselrichtern verbaute MPP-Tracker dazu, dass ein Solarmodul möglichst nah an sein Leistungsmaximum herankommt. Dafür muss es unter einem bestimmten Spannungs- und Stromverhältnis betrieben werden – dem sogenannten Maximum Power Point (MPP). Der Maximum Power Point Tracker (MPPT) wiederum ist ein elektronischer Regler, der ständig diesen optimalen Betriebspunkt des Solarmoduls sucht.
Große Solaranlagen, die gleich ausgerichtet und kaum von unterschiedlichen Verschattungen betroffen sind, werden in der Regel an sogenannte String-Wechselrichter angeschlossen – die in Reihe geschalteten Module eines Strings liefern ihren Strom an einen einzigen Wechselrichter mit einem MPP-Tracker. Bei einem Mikrowechselrichter für Balkonkraftwerke sieht das anders aus: Hier werden normalerweise nur ein bis maximal vier Module mit einem Wechselrichter verbunden. Bei einem Standard-Set mit 900 bis 1.000 Wp Leistung bei zwei Modulen und einem typischen Wechselrichter mit zwei MPP-Trackern hat dann jedes Modul seinen eigenen MPP-Tracker. Das hat zur Folge, dass jedes der beiden Solarmodule an seinem optimalen Betriebspunkt betrieben werden kann. Hängen beide Module unverschattet am selben Balkongeländer, ist das relativ egal – doch bei einer Teilverschattung eines Moduls oder einer anderen Ausrichtung bringt ein zweiter MPP-Tracker ein Leistungsplus.

Wie schließt man einen Wechselrichter an?
Sehr, sehr einfach. Nach dem Aufbau der Solarmodule – egal ob an der Balkonbrüstung oder aufgeständert im Garten – wird noch der Wechselrichter montiert. Oft hinter oder unter den Modulen, zum Beispiel am Balkongitter oder direkt an einer der Halterungen. Anschließend schnappt man sich die Solarkabel, die hinten aus den Panels ragen. Die MC4-Stecker am Ende dieser Solarkabel (einer positiv, einer negativ) werden in die entsprechenden MC4-Eingänge am Wechselrichter gesteckt. Einen zusätzlichen An-Aus-Schalter gibt es dort nicht – fließt Strom von den Modulen, dann läuft der Wechselrichter. Fließt kein Strom, ist er aus.
Über das Stromkabel an der anderen Seite des Wechselrichters wird das Gerät dann mit dem Hausnetz verbunden, damit der erzeugte Wechselstrom auch verbraucht werden kann. Die anschließende Einrichtung der WLAN-Verbindung gestaltet sich je nach Hersteller etwas individueller, in der Regel muss man in der Smartphone-App aber ein Konto anlegen und das WiFi-Modul mit dem Heim-WLAN bekanntmachen – das kann je nach App-Qualität und eventuellen Übersetzungs-Unsauberkeiten etwas mühsam sein, mit ein bisschen Herumprobieren oder einer Google-Recherche gelangt man in der Regel aber ans Ziel.
Wechselrichter: Kompatibilität, Garantie & Co.
Kann ich alle Solarmodule an jeden Wechselrichter anschließen? Vermutlich. Die allermeisten großen PV-Module sind mit MC4-Steckern ausgestattet, die genau zu den Anschlüssen moderner Mikro-Wechselrichter für Balkonkraftwerke passen. Wer die Solar-Leistung von zwei auf beispielsweise vier Module erhöhen möchte, der muss zum Anschließen der zusätzlichen Module einen Y-Stecker nutzen, da die acht MC4-Stecker natürlich nicht in die vier üblichen MC4-Eingänge eines Wechselrichters passen.
Mehr Wp-Leistung anzuschließen als die Wechselrichter-Leistung in Watt beträgt – also zum Beispiel Module mit 1.500 Wp an einen 800-Watt-Wechselrichter – stellt in der Regel kein Problem dar. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass der sogenannte Kurzschlussstrom nicht überschritten wird. Dieser Wert wird in Ampere angegeben und findet sich in der Regel im Datenblatt des Wechselrichters. Wer mehrere Module parallel oder in Reihe zusammenschaltet, sollte beachten: Bei einer Reihenschaltung addiert sich die Spannung (Volt), bei einer Parallelschaltung addiert sich die Stromstärke (Ampere).
Wechselrichter haben in der Regel relativ lange Garantiezeiten von fünf bis zehn Jahren. Hoymiles zum Beispiel brüstet sich mit einer Standard-Garantiezeit von zwölf Jahren auf all seine Wechselrichter. Tatsächlich laufen die allermeisten Wechselrichter auch viele Jahre störungsfrei – sie halten im Schnitt zwar nicht die 25 Jahre durch, die bei Solarmodulen üblich sind, sind aber ebenfalls für einen wartungsfreien Dauerbetrieb im Außenbereich ausgelegt.
Wechselrichter von Balkonkraftwerken können was ab
Apropos Betrieb im Außenbereich: Wechselrichter sollten trotz der Kühlrippen auf einer Geräteaußenseite nach Möglichkeit nicht im prallen Sonnenschein ihren Dienst tun müssen – stattdessen bietet es sich an, den Schatten hinter oder unter dem Solarmodul zu nutzen. Gerne mit etwas Abstand zur Modulrückseite, damit zwischen den erhitzten Solarzellen und dem Inverter kein Hitzestau entsteht.
Die bei allen Markengeräten angegebene IP-Zertifizierung wiederum gibt an, wie gut ein technisches Gerät gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt ist (IP = "ingress protection"). Die erste Zahl steht für die Staubschutzklasse – 6 bedeutet, dass ein Gerät staubdicht ist, demnach keinerlei Partikel ins Innere gelangen können. Die zweite Ziffer steht für den Schutz gegen das Eindringen von Wasser – eine 7 bedeutet, dass ein Gerät nicht nur gegen Starkregen geschützt ist, sondern sogar zeitweiliges Untertauchen schadlos übersteht. 30 Minuten Durchhalten in 1 Meter Wassertiefe sind angesagt. Trotzdem sollte ein Wechselrichter natürlich nicht in einer Pfütze liegen – zum einen, weil das Gerät viele Jahre betrieben werden will, zum anderen gilt die IP-Zertifizierung nicht für die angeschlossenen Kabelverbindungen.
So ein 800-Watt-Wechselrichter wiegt im Schnitt drei bis vier Kilogramm und fühlt sich sehr massiv an – das liegt nicht nur am Metallgehäuse, sondern rührt auch daher, dass der Innenraum des Geräts komplett ausgegossen ist, meist mit einem Kunstharz – das hilft auch bei der IP-Zertifizierung.

Welche Wechselrichter sind empfehlenswert?
Wer den Markt für Balkonkraftwerke in Deutschland im Allgemeinen und wichtige Marktteilnehmer im Speziellen beobachtet, der könnte zu dem Schluss gelangen, dass die von den umsatzstärksten Balkonkraftwerk-Anbietern verwendeten Wechselrichter vermutlich ganz ordentlich funktionieren. Kleines Kraftwerk, Solago und Yuma legen ihren Sets den HMS-800W-2T von Hoymiles bei, Solakon setzt mit dem EZ1 auf ein 800-Watt-Gerät von APSystems. Solarway vertraut dem Envertech EVT800-B, EPP Solar wiederum bietet Sets mit dem Deye Sun M80-G4 oder dem Tsol-MS800 von TSUN an.
Wer es etwas genauer wissen möchte, der surft bei einem tollen Community-Projekt vorbei: der Mikrowechselrichter-Liste im Forum des YouTube-Kanals von Andreas Schmitz ("Der Akku Doktor"). Dort sind Empfehlungen, gemessene Wirkungsgrade und das Vorhandensein gesetzlich vorgeschriebener Zertifikate für viele Modelle fein säuberlich aufgelistet. Hier schneiden beispielsweise folgende Modelle gut ab:
Deye Sun M80-G4
Ecoflow Powerstream
Growatt Neo 800 MX
Hoymiles HMS-800W-2T
Marstek MST-MI0800
Auch ein Blick in die Forschung lohnt sich: Wer sich für große PV-Anlagen interessiert, findet bei der Forschungsgruppe Solarspeichersysteme der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin viele spannende Studienergebnisse. Beim Thema Mikrowechselrichter blicken wir an dieser Stelle aber nach Paderborn, wo unter der Leitung von Prof. Dr. Stefan Krauter am Kompetenzzentrum für Nachhaltige Energietechnik geforscht wird. Von dort stammt auch eine wissenschaftliche Veröffentlichung, die sich mit dem Wirkungsgrad von Mikro-Wechselrichtern für Balkonkraftwerke befasst hat. Dort kommen Geräte von Hoymiles, Envertech, Deye, Bosswerk, APSystems TSUN, Ecoflow oder Anker auf respektable Umwandlungs-Wirkungsgrade von 92 bis 95 Prozent.
Der Wirkungsgrad als Kriterium eines guten Wechselrichters ist nicht zu unterschätzen, gibt er doch an, wie effizient das Gerät seine Arbeit verrichtet. Ein Mikro-Wechselrichter mit einem Wirkungsgrad von zum Beispiel 92 Prozent wandelt 1.000 Watt Gleichstrom so um, dass 920 Watt davon als Wechselstrom verwendet werden können, während 80 Watt bei diesem Prozess (meist in Form von Abwärme) verloren gehen.
Sicherheit von Wechselrichtern: Der NA-Schutz und Stiftung Warentest
Im vergangenen Jahr sorgte die renommierte Stiftung Warentest mit einem Vergleich mehrerer Balkonkraftwerke für Aufsehen – selbst.de berichtete. Zum einen wurden anschließend die Verschattungstests von manchen Experten kritisiert, zum anderen waren teils Modelle im Test, die aufgrund der langen Dauer des Testverfahrens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dann gar nicht mehr erhältlich waren. Außerdem standen die Wechselrichter im Fokus: Drei Komplett-Sets wurden aufgrund von Problemen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit mit der Gesamtnote "mangelhaft" bewertet. Der Störenfried bei allen drei beanstandeten Sets war damals der Hoymiles-Wechselrichter HM-800. Die Stiftung begründete die Abwertung so: "Der mangelhafte Wechselrichter kann Elektrogeräte oder Internetverbindungen im Haus stören − und ebenso Funkverbindungen. Das muss nicht passieren, ist aber durchaus möglich (…). Die gemessenen Werte des mangelhaften Wechselrichters überschritten sehr deutlich die gesetzlichen Grenzwerte zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) – der Wechselrichter hätte also eigentlich gar nicht verkauft werden dürfen."

Yuma, Anbieter eines der kritisierten Sets, veröffentlichte aufgrund der negativen Signalwirkung des Tests eine Stellungnahme, äußerste Verwunderung über die Testergebnisse – u. a. weil das Gerät zuvor beispielsweise von Computer Bild auch in der Kategorie der elektromagnetischen Verträglichkeit sehr gut abgeschnitten haben soll. Hinsichtlich des von der Bundesnetzagentur ausgerufenen Verkaufsstopps des Hoymiles-Geräts verwies Yuma auf eine Aussage der Behörde bei Computer Bild: "Der Hersteller hat angegeben, dass er die Produktion und den Vertrieb der fraglichen Wechselrichter eingestellt hat und ein neues Modell ohne die bekannten Mängel auf den Markt gebracht hat. Ein Rückruf bereits ausgelieferter oder eingebauter Wechselrichter beim Kunden ist nicht erforderlich. Weitere Maßnahmen sind aus Sicht der Bundesnetzagentur aktuell nicht notwendig."
Bereits 2023 war ein anderer Wechselrichter-Skandal aufgedeckt werden: Beim Modell SUN2000G3-EU-230 vom Hersteller Deye fehlte ein Relais, das laut VDE-Norm zum Betrieb eines Wechselrichters zwingend nötig ist. Damit besaß das Gerät nicht den wichtigen NA-Schutz. Dieser Netz- und Anlagenschutz trennt den Wechselrichter automatisch vom Stromnetz, wenn Spannung oder Frequenz außerhalb zulässiger Werte liegen. Er verhindert somit potenziell gefährliche Situationen wie die Einspeisung bei Netzausfall und schützt Netz und PV-Anlage. Im August 2023 vermeldete Deye dann, dass ihre Mikro-Wechselrichter mit dem neuen, externen NA-Schutzrelais von der Bundesnetzagentur freigegeben wurden.
Quellen
Nachrichten von Deye: Mikro-Wechselrichter von Bundesnetzagentur freigegeben
Universität Paderborn: Fachbereich Nachhaltige Energiekonzepte
Wissenschaftlicher Artikel von Prof. Krauter über den Wirkungsgrad von Mikro-Wechselrichtern
Bundesgesetzblatt zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom Mai 2024
Das könnte Sie auch interessieren ...










,type=downsize,aspect=fit;Crop,size=(1650,1650),gravity=Center,allowExpansion;BackgroundColor,color=ffffff;)