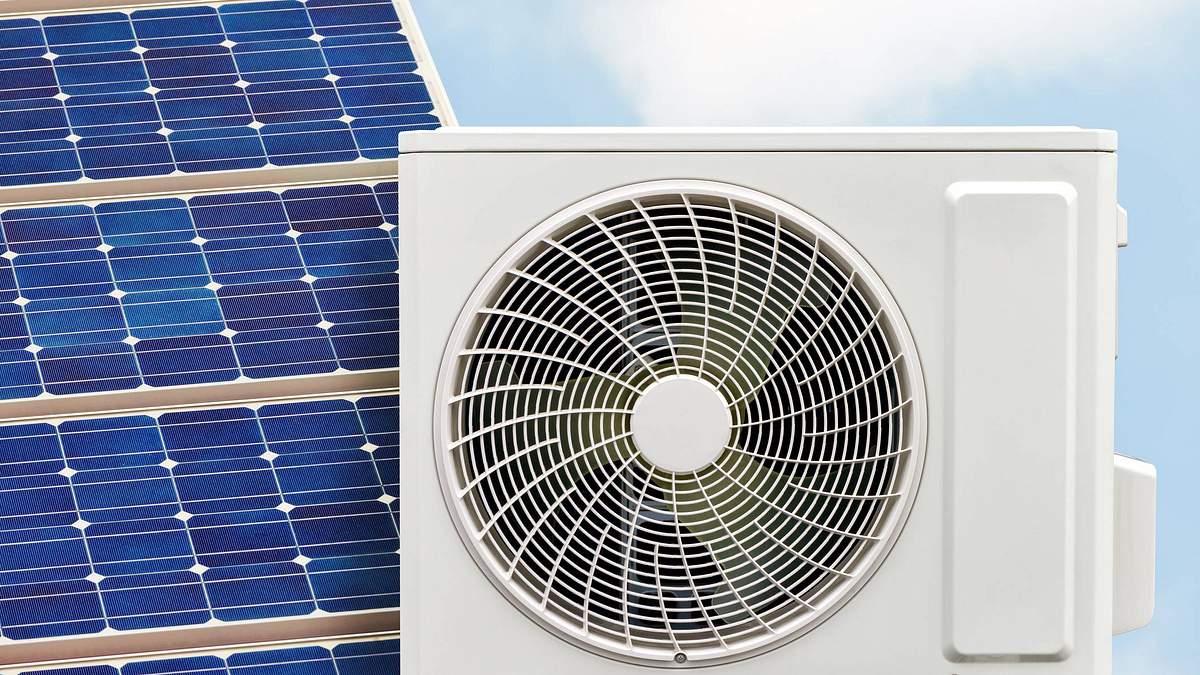Balkonkraftwerk und Wärmepumpe: Was bringt es wirklich?
Balkonkraftwerke sind der Einstieg in die eigene Stromproduktion, Wärmepumpen ein Schlüssel für die Wärmewende. Beides zusammen klingt nach einer perfekten Lösung – doch wie realistisch ist das? Dieser Ratgeber erklärt, was wirklich funktioniert – und wo die Grenzen liegen.
- Die Grundlagen: So funktionieren Balkonkraftwerk und Wärmepumpe
- Schwierigkeiten: Strombedarf und das Sommer-Winter-Dilemma
- Kann ein Balkonkraftwerk – rein technisch – Strom für die Wärmepumpe liefern?
- Sinnvolle Nutzungsszenarien für Balkonkraftwerk und Wärmepumpe
- Technische und rechtliche Aspekte
- Alternativen und Optimierungen
- Fazit: Lohnt sich das?
Balkonkraftwerke und Wärmepumpen gehören zu den Technologien, die in den letzten Jahren besonders viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Beide stehen für den Versuch, den Energieverbrauch im eigenen Haushalt nachhaltiger zu gestalten. Gerne in Kombination mit Einsparpotenzialen und mehr Unabhängigkeit. Während die kleinen PV-Anlagen vor allem den Strombedarf (und damit die Stromkosten) im Alltag reduzieren sollen, gilt die Wärmepumpe als Schlüsseltechnologie für die Wärmewende – also für das Ziel, Heizen zunehmend auf Basis erneuerbarer Energien zu ermöglichen.
Allerdings verlief die Entwicklung bei Wärmepumpen zuletzt nicht ohne Brüche. Der starke Anstieg bei den Installationen 2022 und 2023 kam ins Stocken, als das Gebäudeenergiegesetz (oft verkürzt als “Heizungsgesetz“ bezeichnet) heftig diskutiert wurde. Zudem sorgte zuletzt der Regierungswechsel hin zu einer großen Koalition für zusätzliche Unsicherheit. Viele Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen schoben ihre Entscheidung bezüglich einer neuen Heizung deshalb auf.
Fachlich ist die Lage aber klar: Die Wärmepumpe wird vermutlich die Heiztechnologie der kommenden Jahre und Jahrzehnte sein. Sie bietet nicht nur die Möglichkeit, fossile Brennstoffe zu ersetzen, sondern lässt sich auch optimal mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen – etwa Photovoltaik-Strom – betreiben. Die Kombination aus einer PV-Anlage auf dem Dach und einer Wärmepumpe im Haus ist also definitiv sinnvoll. Weitere Informationen zu diesem Thema – auch zur Dimensionierung der PV-Leistung und des Speichers – haben wir hier für Sie zusammengefasst.
Eigenheimbesitzer und auch Mieter, die noch keine PV-Anlage betreiben, beschäftigt zudem diese Frage: Kann auch ein Balkonkraftwerk einen Beitrag leisten, wenn man eine Wärmepumpe betreibt? Dieser Ratgeber geht dem nach und zeigt, was technisch möglich ist, wo die Grenzen liegen und in welchen Fällen sich die Kombination lohnen kann.
Die Grundlagen: So funktionieren Balkonkraftwerk und Wärmepumpe
Um einschätzen zu können, ob ein Balkonkraftwerk eine Wärmepumpe sinnvoll unterstützen kann, lohnt sich ein Blick auf die grundlegenden Eigenschaften und Funktionsweisen beider Systeme.
Ein Balkonkraftwerk besteht in der Regel aus zwei bis vier Solarmodulen, die über einen Wechselrichter direkt an das Hausstromnetz angeschlossen sind. Bis zu 800 Watt grüner Strom wandern tagsüber von der kleinen Solaranlage in den heimischen Stromkreis und drücken so die Stromrechnung. Der erzeugte Strom wird bei so einem Basis-System nicht zwischengespeichert, sondern direkt im Haushalt verbraucht. Produziert die Anlage gerade mehr Strom, als verbraucht wird, fließt der Überschuss automatisch ins öffentliche Netz.

Eine Wärmepumpe funktioniert ganz anders – und sie dient natürlich dem Heizen, nicht der Stromerzeugung. Sie verwendet elektrische Energie, um Umweltwärme aus Luft, Erdreich oder Grundwasser zum Heizen von Gebäuden nutzbar zu machen. Dank ihrer Funktionsweise, die in etwa einem umgedrehten Kühlschrank gleicht, kann sie aus einer Kilowattstunde Strom bis zu drei, vier oder sogar fünf Kilowattstunden Wärme erzeugen. Trotzdem benötigt eine Wärmepumpe je nach Hausgröße und Heizverhalten mehrere tausend Kilowattstunden Strom pro Jahr. Im Betrieb ruft sie meist kurzfristig eine hohe elektrische Leistung ab, etwa beim Anlaufen des Verdichters oder beim Erwärmen von Warmwasser.
Schwierigkeiten: Strombedarf und das Sommer-Winter-Dilemma
Im zum Teil sehr hohen und auch schwankenden Strombedarf einer Wärmepumpe zeigt sich die erste Diskrepanz bei der Kombination der beiden Geräte: Während ein Balkonkraftwerk nur einige hundert Watt kontinuierlich ins Hausnetz einspeisen kann, schwankt der Bedarf einer Wärmepumpe stark und liegt in einigen Situationen deutlich höher. Hinzu kommt die zeitliche Verfügbarkeit: Balkonkraftwerke erzeugen ihren grünen Strom ausschließlich tagsüber. Zudem entfällt der Großteil ihres Stromertrags auf das Sommerhalbjahr. Der meiste Strom wird von April bis Oktober erzeugt, während der Heizbedarf (und damit der Stromverbrauch einer Wärmepumpe) im Winter am größten ist.
Alles geklärt, Idee gestorben? Zum Glück nicht! Diese Punkte machen zwar deutlich, dass ein Balkonkraftwerk den Strombedarf einer Wärmepumpe sicher nicht vollständig decken kann, durch eine vernünftige Planung sowie die Anschaffung eines Stromspeichers lässt sich aber trotzdem ein nennenswerter Beitrag leisten. Das verringert den Strombezug aus dem Netz und senkt die Stromkosten. Vor allem in Zeiten, in denen die Wärmepumpe mit niedriger Leistung läuft oder lediglich Warmwasser bereitet. Wie das geht, darauf gehen wir im Folgenden ein.
Kann ein Balkonkraftwerk – rein technisch – Strom für die Wärmepumpe liefern?
Ein normales Balkonkraftwerk hat keine Steckdose, in das man Elektrogeräte einstecken kann. Und eine ausgewachsene Wärmepumpenheizung natürlich auch keinen simplen Schuko-Stecker, den man in irgendeine Steckdose im Keller steckt. Zum Glück ist aber keine direkte Verbindung der Geräte nötig, weil beide Systeme über das normale Stromnetz zusammenarbeiten.
Grundsätzlich ist es technisch also möglich, den Strom aus dem sogenannten Steckersolargerät für die Wärmepumpe zu nutzen: Das Balkonkraftwerk speist seinen Solarstrom via Stromkabel direkt in eine Schuko-Steckdose ins Haushaltsnetz ein. Befindet sich die Wärmepumpe gerade im Betrieb, wird sie automatisch auch diesen Solarstrom nutzen.
Im Praxisbetrieb zeigt sich jedoch schnell die oben bereits angesprochene Einschränkung: Der Strombedarf einer Wärmepumpe übersteigt die Leistung eines Balkonkraftwerks. Weil die Wärmepumpe aber anderweitig ans häusliche Stromnetz angeschlossen ist, stellt das natürlich kein Problem dar. Braucht die Wärmepumpe zum Beispiel gerade 1.500 Watt, während das Balkonkraftwerk 250 Watt liefert, dann werden die restlichen 1.250 Watt aus dem Netz gezogen. Man spart in diesem Moment also ein Sechstel seiner Stromkosten.

Sinnvolle Nutzungsszenarien für Balkonkraftwerk und Wärmepumpe
Obwohl ein Balkonkraftwerk die Wärmepumpe nicht allein versorgen kann, gibt es Situationen, in denen die Kombination durchaus einen spürbaren Effekt hat. Entscheidend sind dabei Jahreszeit, die Speicherfrage, die Betriebsweise der Wärmepumpe sowie der Zeitpunkt der Stromproduktion.
Unterstützung im Sommer: In den Sommermonaten läuft die Wärmepumpe in vielen Haushalten vor allem für die Warmwasserbereitung. Der Leistungsbedarf ist dann deutlich geringer als im Heizbetrieb. Gleichzeitig erzeugt das Balkonkraftwerk in dieser Zeit am meisten Strom. Diese Überschneidung führt dazu, dass ein Teil des Warmwasser-Stroms tatsächlich direkt von der Mini-PV-Anlage kommt.
Übergangszeiten im Frühjahr und Herbst: Wenn die Temperaturen noch nicht sehr niedrig sind, arbeitet die Wärmepumpe in einem relativ günstigen Bereich. Der Heizbedarf ist moderat, die PV-Erträge liegen tagsüber derweil noch auf einem gut nutzbaren Niveau. In diesen Phasen kann das Balkonkraftwerk helfen, die Wärmepumpe anteilig zu entlasten.
Balkonkraftwerk mit Solarspeicher: Ein kleiner Speicher mit zwei bis vier Kilowattstunden Kapazität verändert die Situation spürbar. Statt dass überschüssiger Solarstrom mittags ungenutzt ins Netz fließt, kann er zwischengespeichert und später verbraucht werden – etwa am Abend, wenn die Wärmepumpe noch Warmwasser bereitet. Der Speicher verschiebt damit die Nutzbarkeit des Solarstroms in die Zeit, in der die Wärmepumpe tatsächlich aktiv ist, aber draußen keine Sonne mehr scheint. Der Effekt bleibt im Winter begrenzt, im Sommer und in den Übergangszeiten kann die Eigenverbrauchsquote jedoch deutlich ansteigen.
Wenig Effekt im Winter: Anders sieht es leider im Winter aus. Der Heizbedarf ist hoch, die Wärmepumpe ruft viel Leistung ab – gleichzeitig sinkt die Stromproduktion des Balkonkraftwerks deutlich. In dieser Zeit ist die Wirkung ehrlicherweise fast vernachlässigbar. Wer eine große Aufdach-PV-Anlage mit 15 bis 30 Solarmodulen betreibt, der kann aber auch in den Wintermonaten an sonnigen Tagen eine respektable Menge Solarstrom erzeugen, zwischenspeichern und abends für den Heizbetrieb der Wärmepumpe nutzen.
Unterm Strich ergibt sich ein saisonales Bild bei der Kombi aus Balkonkraftwerk und Wärmepumpe: Je sonniger es ist, desto eher kann das Balkonkraftwerk die Wärmepumpe unterstützen. Ein Speicher kann diese Wirkung verstärken, indem er Strom vorhält und dessen Verbrauch in den Abend oder die Nacht verschiebt. Doch auch damit bleibt die Unterstützung im Verhältnis zum gesamten Jahresverbrauch der Wärmepumpe relativ gering.
Technische und rechtliche Aspekte
Ein Balkonkraftwerk wird, wie bereits angesprochen, nicht direkt an die Wärmepumpe gekoppelt, sondern über eine Steckdose als Einspeisepunkt mit dem Hausnetz verbunden. Damit steht der erzeugte Strom allen Verbrauchern zur Verfügung – also auch der Wärmepumpe, sofern sie gerade in Betrieb ist. Eine direkte Versorgung der Wärmepumpe durch das Balkonkraftwerk (oder auch eine ausgewachsene Photovoltaik-Anlage) ist technisch nicht vorgesehen und in der Praxis auch nicht notwendig.
Balkonkraftwerke sind in Deutschland derzeit auf eine Einspeiseleistung von 800 Watt begrenzt. Damit decken sie in den Sommermonaten die übliche Grundlast eines Haushalts, senken die Stromkosten und geben noch ein bisschen Überproduktion ans öffentlich Netz ab. Sie können ohne technische Vorkenntnis und ohne bürokratischen Aufwand betrieben werden. Bei älteren Ferraris-Stromzählern kann es zu einer Rückwärtsdrehung kommen, weshalb der Netzbetreiber den Austausch gegen einen digitalen Zähler anstreben wird. Wer sich für eine Wärmepumpe als Heizungstyp entscheidet, muss sich auch mit deren elektrischem Anschluss befassen und wird automatisch mit der gegebenenfalls nötigen Modernisierung eines alten Zählerschranks konfrontiert.
Ohne ein Energiemanagementsystem weiß die Wärmepumpe nicht, ob gerade Solarstrom aus dem Balkonkraftwerk verfügbar ist. In der Regel läuft sie nach eigenem Bedarf und nimmt den Solarstrom nur zufällig auf, wenn er zeitgleich ins Hausnetz eingespeist wird. Erst mit einem Energiemanager, Smart Meter oder einer App-basierten Steuerung lässt sich der Betrieb der Wärmepumpe gezielt in die Sonnenstunden verschieben. Solche Systeme sind bei kleinen Balkonkraftwerken selten wirtschaftlich, da die Kosten den Nutzen übersteigen. Wer hingegen ein Balkonkraftwerk mit vier Modulen sowie einem Speicher betreibt, der sollte über die Anschaffung eines Smart Meters nachdenken.
Einige Netzbetreiber bieten spezielle Wärmepumpentarife mit reduzierten Stromkosten an, die dann aber über einen separaten Zähler abgerechnet werden. In diesen Fällen kann der Strom aus dem Balkonkraftwerk natürlich nicht den Strombezug am Wärmepumpenzähler drücken.
Alternativen und Optimierungen
Dach-PV als logische Ergänzung zur Wärmepumpe: Während ein Balkonkraftwerk die Stromrechnung nur in kleinem Maßstab entlasten kann, ermöglicht eine klassische Photovoltaikanlage auf dem Dach eine deutlich höhere Eigenversorgung. Mit einer Leistung von sieben bis zwölf Kilowatt Peak lässt sich ein spürbarer Teil des Haushalts- und sogar auch des Wärmepumpenbedarfs decken – insbesondere, wenn die Anlage auf Eigenverbrauch optimiert ist.
Stromspeicher für mehr Flexibilität: Ein Speicher vergrößert den Nutzen von Solarstrom erheblich – egal, ob der vom Balkonkraftwerk oder einer größeren PV-Anlage kommt. Die Batterie sorgt dafür, dass auch in den Abendstunden oder nachts noch selbst erzeugte Energie für die Wärmepumpe verfügbar ist. Das reduziert den Netzstrombezug und erhöht die Unabhängigkeit vom Strompreis.
Smartes Energiemanagement: Eine Schlüsselfunktion liegt in der Steuerung, die zum Beispiel dazu führt, den Betrieb der Wärmepumpe aktiv auf Sonnenstunden zu verschieben. Dazu gehören einfache Zeitprogramme, aber vor allem smarte, vernetzte Systeme, die in Echtzeit Verbrauch, Wetterprognosen und Stromerzeugung abgleichen; im Optimalfall sogar in Kombination mit dynamischen Stromtarifen.
Kombination mit anderen Technologien Zusätzliche Optimierungen ergeben sich, wenn weitere Verbraucher eingebunden werden: Elektroauto, E-Fahrräder oder leistungsstarke Haushaltsgeräte können ebenfalls mit Solarstrom geladen bzw. betrieben werden. Gerade die Kombi von Wärmepumpe und Elektroauto bietet Potenzial, weil sich beide Systeme zum Teil flexibel verschieben lassen und dadurch den Solarstrom besser nutzen. Allerdings muss auch hier dazugesagt werden: Die dafür benötige Menge an Solarstrom wird ein Balkonkraftwerk nie und nimmer decken können, hierfür braucht es eine größere Photovoltaik-Anlage.
Förderungen Sowohl für Photovoltaikanlagen als auch für Wärmepumpen existieren Förderprogramme. Während die Förder-Landschaft für Balkonkraftwerke sehr divers ausfällt (in diesem Artikel finden sie alle Infos), können eine größere PV-Anlage und die Wärmepumpe auf verschiedene Töpfe zugreifen. Speziell für die Wärmepumpen-Förderung über die KfW haben wir einen umfangreichen Ratgeber, der Sie durch den kompletten Antragsprozess begleitet.
Fazit: Lohnt sich das?
Ein Balkonkraftwerk in Kombination mit einer Wärmepumpe zu betreiben, klingt auf den ersten Blick nach einer cleveren Lösung, um Heizkosten zu senken. In der Praxis ist der Effekt jedoch begrenzt. Die geringe Leistung eines Balkonkraftwerks von maximal 800 Watt kann die Grundlast im Haushalt gut abfedern, für den hohen Strombedarf einer Wärmepumpe reicht sie aber nur in Ausnahmefällen.
Spürbare Entlastungen treten dann auf, wenn der Wärmepumpenbetrieb mit Sonnenschein zusammenfällt oder ein Speicher eingebunden wird. Der direkte Nutzen für die Heizkosten bleibt trotzdem überschaubar. Ein Balkonkraftwerk ist deshalb eher ein Beitrag zur allgemeinen Stromersparnis im Haushalt und weniger ein relevanter Faktor für die Wärmepumpe. So ein Balkonkraftwerk lohnt sich zum Glück trotzdem fast immer – aber nicht wegen der Wärmepumpe.
Wer eine Wärmepumpe ernsthaft mit Solarstrom unterstützen will, der kommt an der Investition in eine größere PV-Anlage nicht vorbei. Erst mit höherer Solarleistung, Speicherintegration und smarter Steuerung kann im Praxisbetrieb ein Zusammenspiel entstehen, das das Heizen per Wärmepumpe zu einer extrem nachhaltigen und dann auch besonders günstigen Heizlösung macht.
Das könnte Sie auch interessieren ...