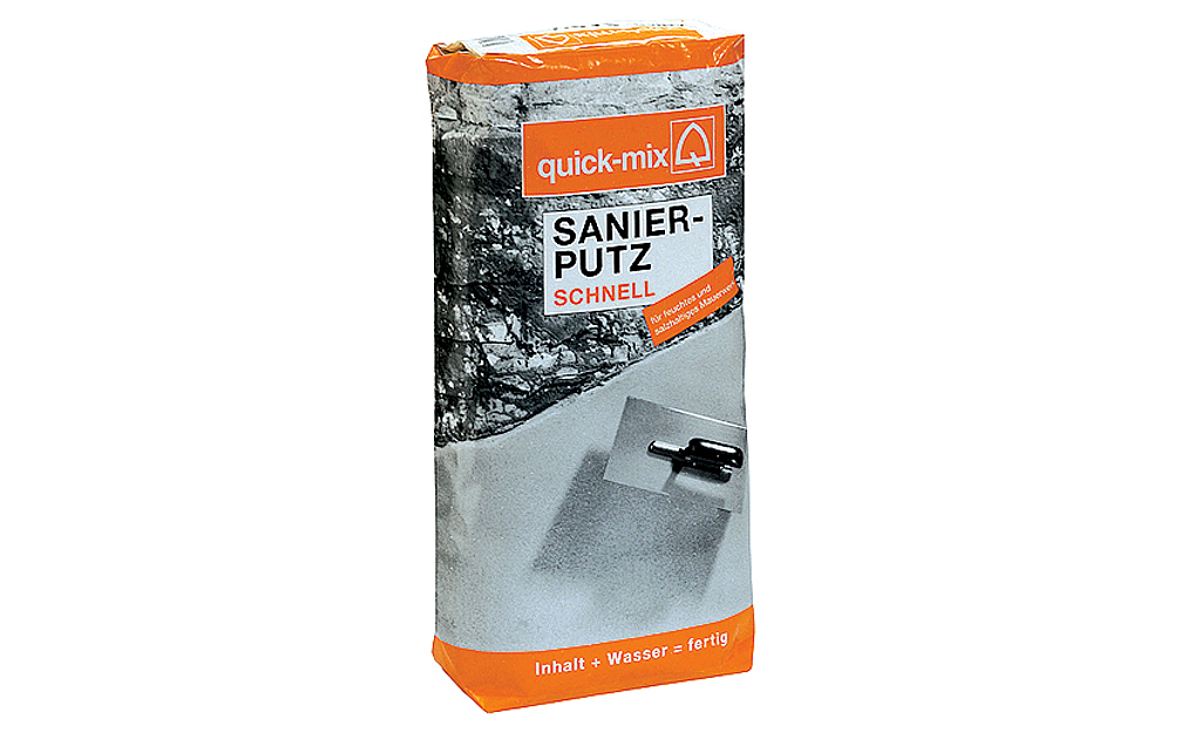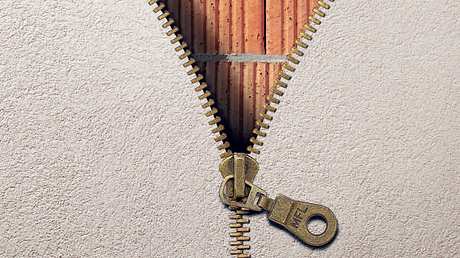Sanierputz im Keller innen & außen auftragen
Mit einem Sanierputz kann man eine feuchte Wand trocknen, Ausblühungen von Bausalzen stoppen und die Zerstörung des Mauerwerks im Keller begrenzen.
Zwar kann auch der beste Sanierputz allein die zerstörerischen Kräfte von Feuchtigkeit und Salzen im Mauerwerk nicht aufhalten, wenn nicht der Grund für die Durchfeuchtung der Wand ermittelt und dessen Ursache behoben wurde.
Doch Sanierputzsysteme nach DIN EN 998-1 sind eine bewährte Lösung für feuchte Wände im Keller, wenn alle anderen Reparaturversuche erfolglos geblieben sind. Hier erfahren Sie, wann Verputzen sinnvoll ist, wie Sie Sanierputze fachgerecht verarbeiten und welche Alternativen es gibt.
Sanierputz: Was ist das?
Ein Sanierputz ist ein hochspezialisiertes, mehrschichtiges Putzsystem, mit dessen Hilfe man eine feuchte Wand trocknen und vor Schäden durch Salz-Ausblühungen schützen kann.
Achtung: Sanierputz ist kein Sperrputz, der manchmal auch als „dichter Sanierputz“ angeboten wird!
Im Unterschied zum klassischen diffusionsoffenen Sanierputz, dichtet ein Sperrputz die feuchtebelastete Wand völlig ab. Auf der Innenseite sinkt die Feuchtebelastung, jenseits des Sperrputzes reichert sich die aufsteigende Feuchte in der Kellerwand aber weiter (unbemerkt) an. Typisches Schadensbild sind dann Aufwölbungen des Putzes oder spontane Abplatzungen ganzer Putz-Schollen an den Wänden.
Wie funktioniert Sanierputz?
Sanierputz ist offenporig, aber wasserabweisend. Er lässt die im Mauerwerk vorhandene salzhaltige Feuchtigkeit bereits in der Putzschicht verdunsten, so die Hersteller. Verputzen Sie salzbelastetes, feuchtes Mauerwerk absolut dicht, sammeln sich in der wandnächsten Putzschicht alle die Bausubstanz schädigenden Salze. Auf diese Opferputz genannte Schicht folgen weitere Lagen aus atmungsaktivem, großporigem Putz, die das Abtrocknen der Wände erleichtern. Die Wand trocknet ab, ohne dass man mit Salzausblühungen zu kämpfen hat.
Welche Eigenschaften hat Sanierputz?
Eine feuchte Kellerwand ist ein ärgerliches Problem. Wollen Sie die Wand trockenlegen, bietet sich neben klassischem Kalkputz vor allem Sanierputz an:
- Sanierputz ist ein mehrschichtig aufgetragenes Putzsystem.
- Sanierputz ist diffusionsoffen und atmungsaktiv: eindringende Feuchtigkeit kann leicht abtrocknen.
- Gleichzeitig besitzt er eine niedrige kapillare Leitfähigkeit: Wasser steigt durch die hohe Porosität nur schwer entgegen der Schwerkraft in der Putzschicht hoch.
- Salzspeichernde Sanierputze binden schädliche Bausalze (wie etwa Salpeter) und verhindern Ausblühungen auf der Wandoberfläche.
- Ihre großporige Putzstruktur ist tolerant gegenüber Volumenänderungen durch auskristallisierende Salze, die Gefahr von Abplatzungen sinkt!
Außerdem sind Außen-Sanierputze wasserabweisend gegen Feuchtigkeit von außen und diffusionsoffen für Wasser(dampf) von innen und damit zur Sanierung feuchter Außenwände und spritzwasserbelasteter Sockel-Flächen geeignet.
Diese Eigenschaften weisen nahezu alle Sanierputzsysteme auf, die WTA-geprüft sind. Die WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege) vergibt Zertifikate, sofern eine Fremdüberwachung durch autorisierte und anerkannte Prüfinstitute erfolgt ist.
Deren Eigenschaften sind im WTA-Merkblatt 2-9-04/D definiert, an denen sich die Hersteller von Sanierputz-WTA orientieren müssen, um das begehrte Prüfsiegel zu erhalten.
Wann nimmt man Sanierputz?
Immer wenn man ein durchfeuchtetes Mauerwerk trocknen will, bei der die Ursache der Durchfeuchtung unklar ist, hilft Sanierputz, feuchtes Mauerwerk zu trocknen und Salzausblühungen im Mauerwerk sowie Putzschäden zu verhindern. Fachleute nutzen Sanierungsputz sowohl für Innenräume (etwa feuchte Keller) als auch für Außenflächen, um etwa durch Salz beschädigte und feuchte Sockelbereiche zu sanieren.
Praxistipp: Wem die Salze der Salpeter-Säure den Putz absprengen oder poröse, krümelnde Ausblühungen auf dem Oberputz bescheren, findet in Sanierputz einen guten Verbündeten!
Warum Sanierputz?
Dunkle, feuchte Flecken auf der Fassade, bröselnde Salzkristalle bis hin zu abplatzenden Putzschichten sind ein Zeichen für geschädigtes Mauerwerk. Geht man nicht dagegen vor, erhöht sich die Feuchte- und Salzkonzentration im Mauerwerk. Mit der Zeit platzt immer mehr Putz ab, Regen dringt zusätzlich ins Mauerwerk ein und zerstört langfristig die (Lager-)Fugen der Wand – am Ende droht der Einsturz des Hauses. Feuchtigkeit im Mauerwerk ist nicht nur ein optisches oder statisches Problem: Auch die Wärmedämmfähigkeit des Bauteils nimmt ab, das Raumklima leidet und die dauerhaft erhöhte Luftfeuchtigkeit steigert die Gefahr von Schimmel. Je länger man mit der Sanierung der schadhaften Wand wartet, desto schwieriger und aufwendiger wird sie!
Wofür Sanierputz: Wo ist Sanierputz sinnvoll?
Zur abschließenden Trockenlegung bei der Sanierung von durchfeuchteten Bauteilen ist Sanierputz ein hilfreiches Material. Wurde die Ursache des Wassereintrags ins Mauerwerk identifiziert und das Leck in der Kellerabdichtung versiegelt, eignet sich Opferputz gut, um die Restfeuchte und noch gelöste Schadsalze aus dem Mauerwerk zu ziehen.
Praxistipp: Bei einer feuchten Kellerwand sollte immer zuallererst die Ursache gefunden und behoben werden! Allerdings verursacht die Erneuerung der Abdichtung von außen viel Arbeit, Schmutz und Kosten. Hier stellt Sanierputz eine praktische Lösung dar, etwa im Keller, wenn sich die Hauswand nicht ohne große Mühen und Kosten von außen behandeln lässt. Ohne intakte Vertikal-Abdichtung kann Sanierputz aber keine dauerhafte Lösung für ein Feuchteproblem im Keller sein.
Die Begriffe Opferputz und Sanierputz werden übrigens oft synonym benutzt. Denn selbst sorgfältig verarbeiteter Sanierputz muss – je nach Salz- und Feuchtigkeitsbelastung der Wand – in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Wenn der Sanierputz sozusagen „vollgesogen“ ist, opfert man ihn: schlägt ihn ab und bringt neuen Opferputz auf, der wieder für mehrere Jahre den Feuchte- und Salzgehalt der verputzten Wand reguliert.
Anleitung: Sanierputz auftragen
Sanierputz wird auf „nacktes“, das heißt von altem Putz befreites, steinsichtiges Mauerwerk aufgetragen. Damit der Sanierputz auf der feuchten, salzbelasteten Wand seine Reparaturarbeit erledigen kann, sollten Sie die Wand vorbereiten, ehe der Sanierputz in mehreren Schichten verarbeitet wird.
Das Video zeigt, wie Sie Putz reparieren:

Wie verarbeite ich Sanierputz?
Zur Verarbeitung von Sanierputz benötigen Sie eine Bürste, eine Glättkelle, ein Reibe- oder Filzbrett sowie eine Bohrmaschine mit Rührquirl.
Wir zeigen Ihnen in der Schritt-für-Schritt-Anleitung oben, wie Sie mit dem Bohrhammer mit Meißelaufsatz den alten Putz abtragen und anschließend fachgerecht den mehrlagigen Sanierputz auftragen.
Zunächst muss der alte Putz vollständig abgeschlagen werden. Entfernen Sie nicht nur lose Putzschollen, sondern den ganzen Verputz! Die Fugen des freigelegten Mauerwerks sollten Sie ebenfalls auskratzen (so tief, wie der Mörtel „weich“ ist). Befreien Sie die Wand von Staub und losen Putzteilen (mit einem weichen Besen). Vor dem Verputzen muss die Mauer vorgenässt werden, das verbessert die Haftung.
Wie trägt man Sanierputz auf?
- Rühren Sie den Sanierputz mit dem Elektroquirl nach Herstellerangaben an.
- Jetzt wird die erste Schicht angemischten Mörtels einlagig als Grundierung kraftvoll mit einer Kelle an die Wand geworfen: Dieser sogenannte Spritzbewurf verschließt die Fugen, erzeugt einen griffigen Putzuntergrund und dient als Haftvermittler für die folgende Opferputz-Schicht.
- Jetzt wird eine erste Lage Porengrundputz aufgezogen: Die ca. 1,0-1,5 cm dicke Schicht speichert später die aus dem Mauerwerk austretenden Salze und verhindert, dass sie weiter durch den Putz auf die Wandoberfläche wandern.
- Auf den Opferputz folgt der offenporige eigentliche Sanierputz: Tragen Sie ihn etwa 2-3 cm hoch gleichmäßig mit einer Kelle auf.
- Wenn der Putz sichtbar anzieht (etwa nach 2h), können Sie die Oberfläche mit dem Filzbrett glattziehen.
Jetzt ist das Sanierputzsystem eigentlich schon vollständig aufgebaut – ein Armierungsgewebe muss nicht eingeputzt werden. Für mindergenutzte Kellerräume reicht diese Ausführung. Wer Wert auf eine besonders glatte Oberfläche legt, kann nach dem vollständigen Durchtrocknen des Schichtaufbaus noch einen passenden Oberputz wenige Millimeter stark aufbringen.
Wie lange trocknet Sanierputz?
Das kommt sehr auf die jeweilige Putzschicht an: Der Vorspritzmörtel sollte drei Tage trocknen können, ehe die nächste Schicht aufgebracht wird. Bei den folgenden Lagen entscheidet die Schichtdicke über die Trocknungszeiten. Es gilt die bewährte Faustregel: Pro Millimeter Putz-Stärke ist eine Trocknungszeit von etwa einem Tag einzuhalten. Als grober Richtwert können Sie sich merken: Nach 14 Tagen ist der Sanierputz trocken und kann weiterbearbeitet werden. Stellen Sie in dieser Zeit sicher, dass der Raum temperiert und belüftet ist!
Welcher Sanierputz ist der beste?
Sanierputz klingt nach einer Wunderwaffe gegen feuchte Wände, doch sind Sanierputze tatsächlich die Lösung für alle Feuchteschäden in Kellern und Außenmauern oder gibt es Alternativen zum Sanierputz? Wo liegen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Verfahren? Wir haben zwei Experten um ihre Meinung gebeten.
Mit Sanierputz gegen Feuchtigkeit: Wassereintritt von außen stoppen
Die Vorteile von Sanierputz erläutert Dipl.-Ing. Raiko Siebert von quick-mix:
„Für die Sanierung von feuchtem und salzbelastetem Mauerwerk gibt es nur eine funktionierende Lösung: Sanierputze. Diese haben sich im Laufe der Zeit auf vielen Baustellen bestens bewährt. Dabei sind Sanierputze vor allem als dauerhafte Lösung konzipiert und nicht etwa als Opferschicht zu verstehen, die nach kurzer Zeit wieder abgeschlagen und erneuert werden muss.
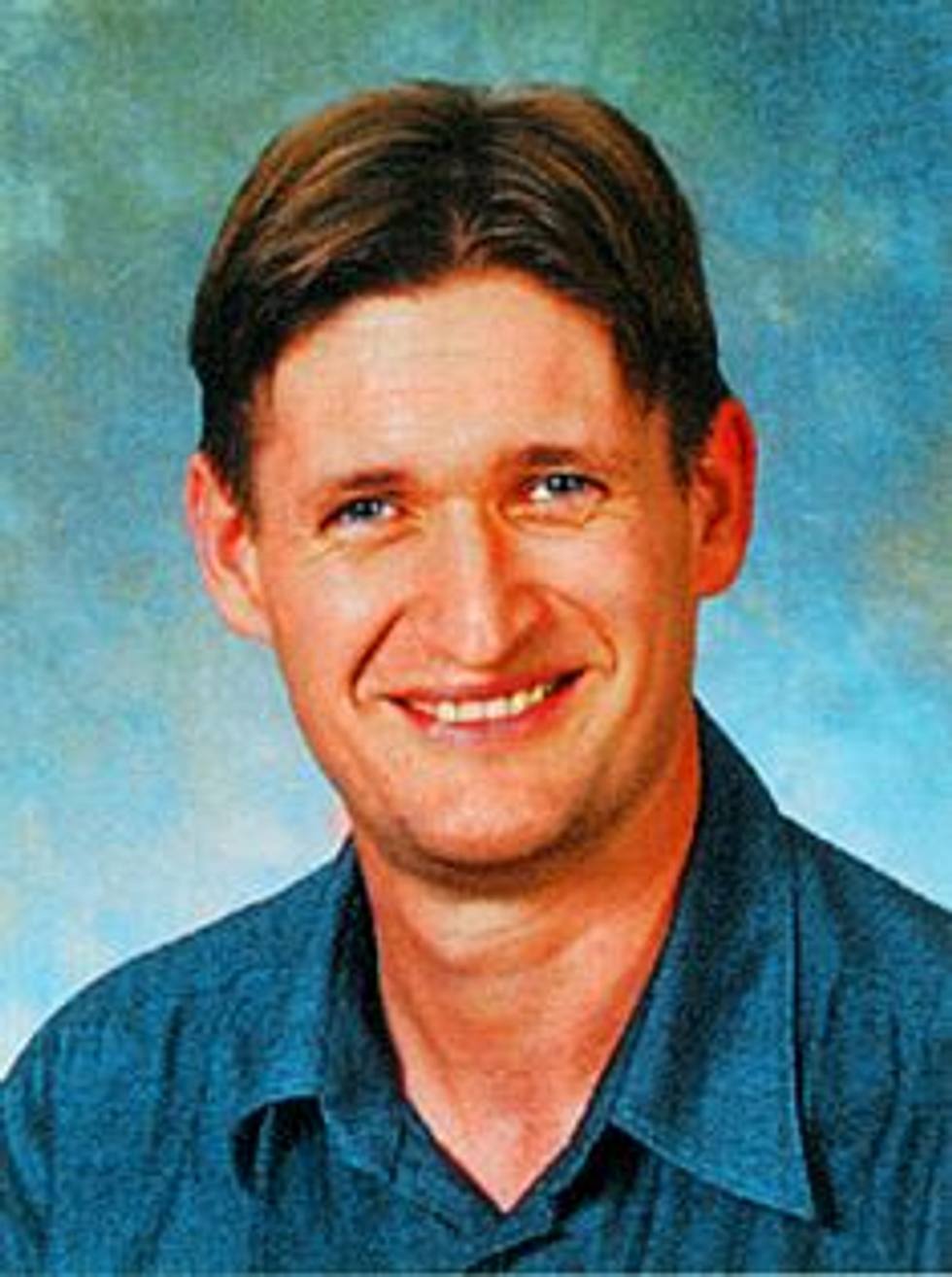
Das Wirkungsprinzip beruht im Wesentlichen auf zwei Faktoren: Zum einen sind Sanierputze sehr diffusionsoffen, d.h. Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf kann nach außen abgegeben werden. Zum anderen sorgt ein definiertes Porenvolumen innerhalb des Putzes für die Aufnahme von bauschädlichen Salzen. Mit dieser Funktionsweise wirken Sanierputze entgegengesetzt zu Sperrputzen oder Dichtschlämmen. Demnach können Sanierputze auch keine Abdichtungsschicht ersetzen. Sanierputze bieten zum Beispiel die technische Sicherheit, um bauschädliche Salze am Gebäude in Schach zu halten. Bei der Verarbeitung muss darauf geachtet werden, dass der Untergrund zur Aufnahme von Sanierputzen geeignet ist, also u. a. fest, oberflächentrocken und staubfrei ist.“
Sanierputz oder Kalkputz – was ist besser?
Sanierputze taugen weder für eine Entsalzung noch für eine Entfeuchtung feuchter Mauern – Kalkputz wäre die bessere Alternative, fasst Dipl.-Ing. Architekt Konrad Fischer die Nachteile von Sanierputz zusammen:

„Sanierputz gilt als Heilmittel für feuchte, salzige Wände. In seine hydrophoben Poren dringt laut mir vorliegender Fachliteratur aber weder Feuchte noch Salz ein, da sie Wasser abweisen. H. G. Meier, ein renommierter Sanierputzentwickler, sagt dazu: Sanierputze dienen deshalb primär weder für eine Entsalzung noch für eine Entfeuchtung von Mauerwerken.
In rissgefährdetem, schadsalzhaltigem Zement-Sanierputz entstehen bei sulfatbelastetem Mauerwerk sogar Treibmineralien, die dazu führen, dass der Putz abreißt. Auf wasserabweisendem Sanierputz haftet außerdem nur kunstharzhaltige und kapillarsperrende Beschichtung: Dispersionssilikat (mineralische Farbe), Silikonharzemulsions- und Dispersionsfarbe.
Darunter trocknet die Fassade sowie das in Risse und als Kondensat eingedrungene Wasser jedoch schlecht kapillar aus. Dampfdiffusion spielt dabei also keine Rolle. Bekannte Folgen: Auffeuchtung des Bauwerks, abplatzende Putz- und Anstrichschwarten.
Aus meiner Altbaupraxis empfehle ich kalkgetünchten Luftkalkputz. Dann trocknet Wasser ungehindert nach außen ab – zehnmal schneller als aus Zementmörtel! Kalkmörtel besitzt keine treibmineral-, ausblüh- und rissfördernden Schadsalze wie Zement, Trass oder Hydraulkalk. Richtig verarbeitet und in frostfreier Periode abgebunden, bietet die Luftkalktechnik für altes Mauerwerk die schonendste Lösung. Da Wasser und Salzlösung aus dem Untergrund in Kalkmörtel ungehindert eindringen, ist er auch als Opferputz effektiver. Und deutlich billiger.“
Mehr Informationen zum Thema Altbau und Denkmalpflege bietet das Online-Magazin von Konrad Fischer >>
(Anmerkung der Redaktion: Der Fachartikel „Putze im Fachwerkbau“ von H. G. Meier wurde veröffentlicht in Ausgabe 5/1994 „Sanierung - Ergänzung – Umnutzung“ (S. 652-654) der Zeitschrift „Detail“)
Wie lange hält Sanierputz?
Die Haltbarkeit eines Sanierputzes hängt vom Grad der Durchfeuchtung der Wand und entscheidend von der Frage, ob die Ursache des Feuchteeintrags beseitigt wurde! Kombiniert man eine nachträglich außen angebrachte Isolierung mit einem mehrlagigen Sanierputzsystem innen, ist die Lebensdauer eines Sanierungsputzes vergleichbar mit der eines normalen Putzes auf trockenem Mauerwerk.
Wird der Sanierputz allerdings (notgedrungen) als alleinige Maßnahme gegen die Mauerwerksdurchfeuchtung eingesetzt, verkürzt sich dessen Haltbarkeit. Doch auch unter diesen schlechten Voraussetzungen hält Sanierputz erfahrungsgem��ß etwa zehnmal länger als herkömmlicher Wandputz.
Wie teuer ist Sanierputz?
Diese „Zaubereigenschaften“ haben natürlich ihren Preis: Was also kostet ein Quadratmeter Sanierputz? Grob sollte man mit 50 Euro pro Quadratmeter Sanierungsputz kalkulieren. Wer selbst verputzt, kann natürlich viel Geld sparen: Im Baustoffhandel kostet ein 25-kg-Sack Sanierputz je nach Hersteller durchschnittlich 20 Euro.
Womit Sanierputz streichen?
Wollen Sie die Innenwand anschließend (farbig) streichen, steht sogleich die Frage im Raum: „Welche Farbe ist für Sanierputz geeignet?“
Zum Überstreichen von Sanierputz sollten Sie ausschließlich spezielle Silikat- oder Silikonharz-Farben verwenden. Anstriche mit herkömmlichen Lacken, Acrylat- oder Dispersionsfarben verschließen den offenporigen Putz und verhindern das Abtrocknen der verputzten Innenwand.
Das könnte Sie auch interessieren ...