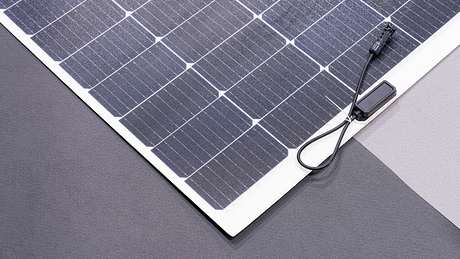Balkonkraftwerk vs. PV-Anlage: Das sind Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Die Begriffe PV-Anlage und Balkonkraftwerk werden gerne synonym verwendet. Doch obwohl es sich grundsätzlich um Anlagen mit dem gleichen Verwendungszweck dreht, gibt es große Unterschiede. Wir erklären Kosten, Nutzen und rechtliche Voraussetzungen.
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link bzw. mit Symbol) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
- PV-Anlage und Balkonkraftwerk: Gleiches Grundkonzept, unterschiedliche Größe
- Balkonkraftwerke: Einfache Plug-and-Play-Lösungen
- PV-Anlagen: Umfassende Gesamtsysteme
- PV-Anlage vs. Balkonkraftwerk: Installationsaufwand und technische Komplexität
- Leistungsfähigkeit und Energieertrag
- PV-Anlage und Balkonkraftwerk: So teuer wird’s
- Wie flexibel sind Balkonkraftwerke und PV-Anlagen?
- Diese rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es
- Ideale Einsatzgebiete für Balkonkraftwerke und PV-Anlagen
- Parallelbetrieb: Kombinationsmöglichkeiten und Grenzen
- Integration in die bestehende PV-Anlage
- Separater Parallelbetrieb
- Balkonkraftwerk oder PV-Anlage: Was passt für mich?
- PV-Anlage und Balkonkraftwerk: Eine Technologie für unterschiedliche Anforderungen
Die Begriffe Balkonkraftwerk und PV-Anlage beschreiben grundlegend zwei unterschiedliche Varianten derselben Technologie. Dieser Artikel erläutert die wichtigsten Unterschiede zwischen kompakten Balkonkraftwerken und großen Photovoltaik-Dachanlagen. Dabei stehen technische Merkmale und wirtschaftliche Aspekte genauso im Fokus wie die passenden Einsatzgebiete der jeweiligen Systeme.
PV-Anlage und Balkonkraftwerk: Gleiches Grundkonzept, unterschiedliche Größe
Solarenergie bleibt Solarenergie. Sowohl Balkonkraftwerke als auch ausgewachsene Photovoltaik-Anlagen nutzen dasselbe Grundprinzip: Solarzellen wandeln Sonnenlicht in elektrische Energie um, die sich dann ins Stromnetz einspeisen lässt. Der Hauptunterschied liegt in der Größe, Leistung und der Einbindung ins Gebäude.
Balkonkraftwerke sind kompakte Solaranlagen mit einer gesetzlich begrenzten Einspeiseleistung von maximal 800 Watt. Die Gesamtinstallation darf Module mit einer maximalen Gesamtleistung von bis zu 2.000 Watt Peak (Wp) umfassen. Große Dachanlagen unterliegen hingegen keinerlei vergleichbarer Leistungsgrenzen. Sie ermöglichen bei optimaler Auslegung eine weitgehende Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz.
Balkonkraftwerke: Einfache Plug-and-Play-Lösungen
Ein Balkonkraftwerk besteht typischerweise aus:
Ein bis vier Solarmodulen (je nach Leistungsklasse)
Mikro-Wechselrichter zur Umwandlung von Gleichstrom in netztauglichen Wechselstrom
Anschlusskabel mit Schuko- oder Wieland-Stecker zur direkten Verbindung mit dem Hausnetz
Der vom Balkonkraftwerk erzeugte Strom wird direkt in den Stromkreis der Wohnung oder des Hauses eingespeist und verringert entsprechend den Strombezug aus dem öffentlichen Netz. Überschüssige Energie, die nicht direkt verbraucht wird, gelangt ohne Vergütung ins öffentliche Netz, falls keine separate Speicherlösung vorhanden ist.

PV-Anlagen: Umfassende Gesamtsysteme
Dach-Photovoltaikanlagen bestehen aus:
Mehrere Solarmodule mit Gesamtleistungen klar im Kilowatt-Bereich
Leistungsfähiger zentraler Wechselrichter
Professionelle Befestigungssysteme für die Dachmontage
Umfangreiche Verkabelung
Optional: Batteriespeicher zur Erhöhung des Eigenverbrauchs
Netzanschluss mit bidirektionaler Messung für Einspeisung und Bezug
Die Funktionsweise folgt demselben Grundprinzip wie beim Balkonkraftwerk, jedoch in deutlich größerem Maßstab. Der erzeugte Strom wird vorrangig im Hausnetz verbraucht, in Batterien zwischengespeichert oder gegen Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ins öffentliche Netz eingespeist.
PV-Anlage vs. Balkonkraftwerk: Installationsaufwand und technische Komplexität
Balkonkraftwerke zeichnen sich durch ihre besonders einfache Installation aus. Die Montage erfolgt anhand beiliegender Anleitungen typischerweise durch den Käufer selbst und benötigt keine besonderen Fachkenntnisse. Geeignete Montageorte sind Balkone, Terrassen, Flachdächer von Gartenhäusern und Garagen sowie ebene Flächen im Garten. Der elektrische Anschluss kann über normale Schutzkontakt-Stecker an vorhandene Stromkreise erfolgen.
PV-Anlagen erfordern hingegen immer eine fachgerechte Installation durch zertifizierte Fachbetriebe. Dies umfasst Berechnungen zur Dachlast, feste Montagesysteme, komplexe Verkabelungen sowie die Einbindung in die elektrische Infrastruktur des Hauses. Der Installationsprozess kann je nach Verfügbarkeit der Fachfirmen mehrere Wochen bis Monate dauern.

Leistungsfähigkeit und Energieertrag
Der Leistungsunterschied zwischen beiden Systemkategorien ist erheblich. Während Balkonkraftwerke bei optimaler Ausrichtung jährliche Erträge von bis zu 1.100 Kilowattstunden erzielen können, produzieren Dach-PV-Anlagen je nach Größe wesentlich mehr Strom im Jahr.
Eine durchschnittliche PV-Anlage mit zehn kWp Leistung erzeugt unter mitteleuropäischen Bedingungen zum Beispiel bis zu 12.000 kWh jährlich und kann damit den Strombedarf eines Einfamilienhauses inklusive Wärmepumpe rechnerisch zu großen Teilen decken. Dies hängt aber von den Stromspeichermöglichkeiten ab, da während der Heizsaison im Winter deutlich weniger Solarstrom generiert wird.
PV-Anlage und Balkonkraftwerk: So teuer wird’s
Die Anschaffungskosten von einer großen PV-Anlage und einem kompakten Balkonkraftwerk unterscheiden sich deutlich:
Balkonkraftwerke kosten zwischen 300 und 1.000 Euro, je nach Leistung, Ausstattung und Qualität.
PV-Anlagen bedeuten große Investitionen ab 8.000 Euro aufwärts. Typischerweise liegen sie inklusive Speicherlösung für Einfamilienhäuser eher im fünfstelligen Bereich.
Während bei Balkonkraftwerken hauptsächlich Einsparungen bei der Stromrechnung im Vordergrund steht, bieten Dachanlagen zusätzliche Einnahmemöglichkeiten durch die EEG-Vergütung. Theoretisch wäre diese Vergütung auch für Balkonkraftwerke möglich, allerdings übersteigen die technischen Anforderungen (eigener Zähler, spezieller Netzanschluss) den wirtschaftlichen Nutzen bei den eher geringen Einspeisemengen deutlich.
Die Amortisationszeiten variieren entsprechend:
Balkonkraftwerke: typischerweise drei bis sechs Jahre
PV-Anlagen: je nach Auslegung und Eigenverbrauchsanteil acht bis 16 Jahre
Dabei ist allerdings zu beachten, dass dieser Zeitraum nicht nur von den Anschaffungskosten, sondern auch vom Strompreis abhängt. Steigt die Belastung durch den Strompreis, reduziert sich die Zeit, in der sich die Anlage amortisiert. Auch der Stromverbrauch spielt eine Rolle. Wird zum Beispiel regelmäßig tagsüber ein E-Auto mit der PV-Anlage geladen, kann sich das direkt auf die Amortisierung auswirken.

Wie flexibel sind Balkonkraftwerke und PV-Anlagen?
Ein wichtiger Vorteil von Balkonkraftwerken liegt in ihrer Beweglichkeit. Bei Umzügen können die Systeme relativ problemlos abgebaut und am neuen Wohnort wieder installiert werden. Die Investition bleibt somit auch bei Wohnortwechseln erhalten. Dies macht Balkonkraftwerke auch für Mieter attraktiv.
Große Dachanlagen sind fest mit dem Gebäude verbunden. Ein Abbau und eine Neuinstallation sind zwar theoretisch möglich, erfordern jedoch umfangreiche Prüfungen der Module auf Schäden und verursachen hohe Kosten, die den Restwert der Anlage oft übersteigen.
Diese rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es
Die rechtlichen Anforderungen zwischen Balkonkraftwerken und PV-Anlagen unterscheiden sich erheblich. Für Balkonkraftwerke gelten seit der Einführung des Solarpaket I im Mai 2024 diese vereinfachten Regeln:
Einspeiseleistung auf 800 Watt begrenzt
Vereinfachte Anmeldung im Marktstammdatenregister
Meist keine baurechtliche Genehmigung erforderlich
Bei Mietwohnungen sollte man den Vermieter informieren
Große PV-Anlagen unterliegen umfassenderen Anforderungen:
Mögliches Genehmigungsverfahren, je nach lokaler Bauordnung
Verpflichtende Registrierung im Marktstammdatenregister
Technische Abnahme nach VDE-Normen
Netzanschlussvertrag mit dem lokalen Netzbetreiber
Steuerliche Registrierung bei geplanter Einspeisevergütung
Ideale Einsatzgebiete für Balkonkraftwerke und PV-Anlagen
Balkonkraftwerke eignen sich besonders für:
Mietwohnungen mit Balkon, Terrasse oder Gartenanteil
Wohnungseigentümer ohne Zugriff auf gemeinsame Dachflächen
Personen mit begrenztem Budget
Standorte mit wenig Installationsfläche
Nutzer, die einfache Plug-and-Play-Lösungen bevorzugen
Situationen, in denen Flexibilität und Mobilität wichtig sind
Die typische Ersparnis durch Balkonkraftwerke liegt zwischen 60 und 250 Euro jährlich, abhängig von Standort, Ausrichtung und lokalen Strompreisen.
Dach-Photovoltaikanlagen sind besonders geeignet für:
Hausbesitzer mit passenden Dachflächen
Gebäude mit hohem Stromverbrauch
Standorte mit dem Ziel der Energieunabhängigkeit
Kombinationen mit Wärmepumpen oder Elektrofahrzeugen
Situationen, in denen maximale Solarerträge angestrebt werden
Langfristige Investitionen zur Wertsteigerung der Immobilie
Bei optimaler Auslegung können PV-Anlagen den Strombezug aus dem öffentlichen Netz spürbar reduzieren und bei Integration von Speicherlösungen einen hohen Unabhängigkeitsgrad erreichen.
Parallelbetrieb: Kombinationsmöglichkeiten und Grenzen
Die Kombination von Balkonkraftwerken und PV-Anlagen ist grundsätzlich möglich, jedoch mit unterschiedlichen Integrationsoptionen verbunden. Dabei gibt es die Möglichkeit der Integration in eine bestehende Anlage sowie die Variante des separaten Parallelbetriebs
Integration in die bestehende PV-Anlage
Bei dieser Variante wird das Balkonkraftwerk technisch in die vorhandene Dachanlage eingebunden. Vorteile dieser Lösung:
Einbeziehung der Balkonkraftwerk-Erzeugung in die EEG-Vergütung
Einheitliche Überwachung und Steuerung
Optimierte Gesamtbilanzierung
Der technische Aufwand ist jedoch beträchtlich und erfordert die Unterstützung durch Fachleute. Die Wirtschaftlichkeit dieser Integration ist in den meisten Fällen nicht gegeben, da der Mehrertrag den Installationsaufwand nicht rechtfertigt.
Separater Parallelbetrieb
Alternativ lässt sich das Balkonkraftwerk als unabhängiges System neben der PV-Anlage betreiben. Diese Lösung bietet:
Einfache Installation ohne Eingriff in die bestehende Anlage
Erhöhung des Eigenverbrauchs in bestimmten Gebäudebereichen
Nutzung zusätzlicher, für die Dachanlage ungeeigneter Flächen
Der separate Betrieb führt jedoch zu keiner Einspeisevergütung für das Balkonkraftwerk und erfordert eine genaue Planung, um eine wirksame Nutzung des erzeugten Stroms sicherzustellen.
Ob der Parallelbetrieb Sinn ergibt, hängt stark von den individuellen Gegebenheiten ab. Bei bereits vorhandener, optimal dimensionierter PV-Anlage und ungünstigen Bedingungen für ein Balkonkraftwerk (etwa Nordbalkon) ist der zusätzliche Ertrag vernachlässigbar. Bei bestimmten Konstellationen, wie einem nicht verschatteten Südbalkon bei gleichzeitig eher suboptimal ausgerichteter Dachanlage, kann die Ergänzung durch ein Balkonkraftwerk durchaus wirtschaftlich sein.
Balkonkraftwerk oder PV-Anlage: Was passt für mich?
Die Entscheidung zwischen Balkonkraftwerk und PV-Anlage sollte anhand folgender Kriterien getroffen werden:
Verfügbare Montagefläche und deren Eignung (Ausrichtung, Verschattung)
Eigentumsverhältnisse (Eigentum vs. Miete)
Verfügbares Budget und Finanzierungsmöglichkeiten
Stromverbrauchsmuster des Haushalts
Langfristige Wohnperspektive (geplante Wohndauer)
Technisches Interesse und Bereitschaft zur Selbstmontage
Energetische Zielsetzung (Kostenersparnis vs. Unabhängigkeit)
Für Mietwohnungen stellt das Balkonkraftwerk in der Regel die einzige praktikable Option dar, um an der dezentralen Energiewende durch Photovoltaik teilzunehmen. Hausbesitzer sollten hingegen sorgfältig prüfen, ob die höhere Investition in eine Dachanlage durch den Mehrertrag und die Wertsteigerung der Immobilie gerechtfertigt ist.
PV-Anlage und Balkonkraftwerk: Eine Technologie für unterschiedliche Anforderungen
Balkonkraftwerke und PV-Anlagen sind keine konkurrierenden, sondern sich ergänzende Technologien für unterschiedliche Anwendungsfälle. Während Balkonkraftwerke durch einfachen Zugang zur Solarstromerzeugung überzeugen, bieten Dachanlagen maximale Erträge und langfristige Wirtschaftlichkeit.
Die Wahl zwischen beiden Optionen wird hauptsächlich durch die individuellen Rahmenbedingungen bestimmt. In bestimmten Fällen kann sogar die Kombination beider Systeme sinnvoll sein, wobei ein Parallelbetrieb sorgfältig geprüft werden sollte, um rechtliche und technische Probleme zu vermeiden.
Unabhängig von der gewählten Lösung leisten beide Technologien einen sinnvollen Beitrag zur dezentralen Energiewende und verringern die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Die fortschreitende technische Entwicklung und Optimierung beider Systemkategorien wird deren Attraktivität in den kommenden Jahren vermutlich weiter erhöhen.
Das könnte Sie auch interessieren ...